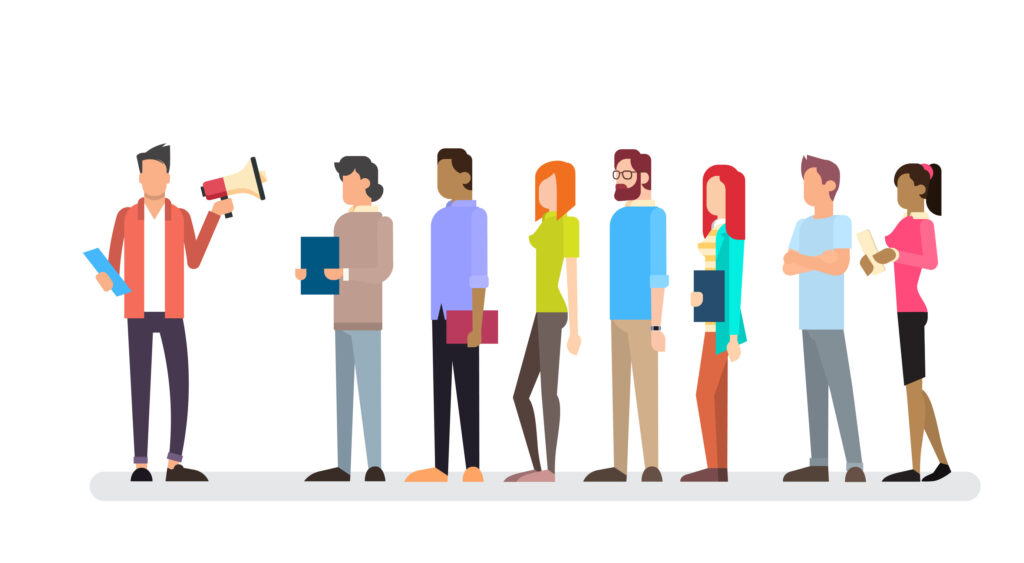
Gruppendynamik vor dem Aus ist eine Befürchtung, seit die Generation Z in einem Zeitschrifteninterview vom Oktober 2024 mit Gruppenuntauglichkeit in Verbindung gebracht worden ist. Diese Verbindung ist entweder eine sensationelle Entdeckung aus der psychotherapeutischen Praxis oder nur eine spontane Vermutung des Interviewten. Die Nachfrage des interviewenden Redakteurs stieß auf eine unvermutete Sprachlosigkeit. Die Dichotomie dieser Äußerung bleibt also ungeklärt. Als Folge der Gruppenuntauglichkeit könnte die Gruppendynamik vor dem Aus stehen. In Teil 1 wird die Gruppe als Grundlage der Gruppendynamik analysiert. Der Teil 2 beschäftigt sich mit der Gruppendynamik und der Frage, ob die Gruppendynamik vor dem Aus steht.
Gruppe
Die Gruppe ist Voraussetzung für die Gruppendynamik. Sie ist ein Fall von „Mensch im Plural“. So ordnet sie der österreichische Sozialpsychologe Peter R. Hofstätter (1913 – 1994) sie massenpsychologisch ein. („Gruppendynamik, Kritik der Massenpsychologie“, S. 20 ff)
Massenpsychologische Einordnung der Gruppe
Die massenpsychologische Einordnung der Gruppe berücksichtigt die Pluralitäten Masse, Menge, Klasse und Verband. Die Familie bleibt für eine Betrachtung der Pluralitäten im Arbeitsleben ausgeschlossen.
Die Masse
Die Masse definiert erstmals der französische Mediziner, Psychologe, Soziologe und Begründer der Massenpsychologie Gustave Le Bon (1841 – 1931).
Definition der Masse
Mit der Definition der Masse leitet Le Bon sein 1895 erschienenes Standardwerk ein: „Im gewöhnlichen Wortsinn bedeutet Masse eine Vereinigung irgendwelcher einzelner von beliebiger Nationalität, beliebigem Beruf und Geschlecht und beliebigem Anlaß der Vereinigung. …Tausend zufällig auf einem öffentlichen Platz, ohne einen bestimmten Zweck versammelte einzelne bilden keineswegs eine Masse im psychologischen Sinne. Damit sie die besonderen Wesenszüge der Masse annehmen, bedarf es des Einflusses gewisser Reize, …“. („Psychologie der Massen“, S. 10)
Zu diesen Reizen zählen Treibhaftigkeit, Reizbarkeit, Unfähigkeit zu logischem Denken, Beeinflussbarkeit und Führerlosigkeit. Sie verbinden sich zu einer Massenseele, die den Personen den vorübergehenden Status der Verbundenheit als Masse verleiht.
Massenseele
Die von Le Bon beschriebene Massenseele stößt bei dem österreichischen Arzt und Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud (1856 – 1939) auf Bedenken. Er will „zur Aufklärung der Massenpsychologie den Begriff der Libido verwenden“, wie er 1921 in „Massenpsychologie und Ich-Analyse“ schreibt. „Wir heißen so (Libido) die als quantitative Größe betrachtete – wenn auch derzeit nicht meßbare – Energie solcher Triebe, welche mit all dem zu tun haben, was man als Liebe zusammenfassen kann.“ (Studienausgabe, Bd. IX, S. 85)
Die Libido-Theorie entwickelt daraus die vier Zustände der Massenpsychologie Verliebtheit, Hypnose, Massenbildung und Neurose. Sie wirken auf unterschiedliche Weise fördernd oder hemmend auf die Massenseele ein. (siehe, ebda. Nachträge, S. 133 f)
Doch die Massenseele unterliegt der Kritik der negativen Vereinheitlichung: „Die Masse vernichtet alles, was ausgezeichnet, persönlich, eigen begabt und erlesen ist. Wer nicht „wie alle“ ist, wer nicht „wie alle“ denkt, läuft Gefahr, ausgeschaltet zu werden.“, schreibt der spanische Philosoph und Soziologe José Ortega y Gasset (1883 – 1955). („Der Aufstand der Massen“, S. 12)
Die Menge
„Der Begriff der Menge ist quantitativ und visuell.“ (Ortega, ebda., S. 8). Sie ist „eine Ansammlung von Menschen, die – außer ihrem Menschsein – nichts miteinander verbindet.“ (Ortega, ebda., Enzyklopädisches Stichwort „MASSE“, S. 142) Die Menge ist in ihrer Zufälligkeit die Grundstruktur der Masse ohne psychologische Eigenbedeutung.
Die Klasse
Die Klasse ist eine soziale Kategorie, die über gemeinsame Merkmale oder eine Kombination aus Merkmalen definiert wird. Ein Beispiel sind Mercedes-Besitzer. Sie haben über den Besitz dieser Automarke hinaus kaum gemeinsame Interessen und kennen sich zum größten Teil nicht einmal untereinander. Ein Bedarf an Interaktion der Mitglieder besteht nicht.
Der Verband
Der Verband ist eine Pluralität, die mit einer Klasse vergleichbar ist, aber im Gegensatz zu ihr mindestens eine handlungsrelevante Eigenschaft hat. Um diese Eigenschaft in gemeinsame Interessen umzuwandeln, benennt Le Bon einen Verbandszweck und bestimmt einen Vorstand zu dessen Dursetzung.
Die Gruppe
Die Gruppe ist eine Personenmehrheit, die Le Bon noch der Massenpsychologie zuordnete. Bereits zu seinen Lebzeiten entwickelte sich die Psychologie des Nebeneinanders von Personen. Sie ist als Vorgängerin der Gruppenpsychologie zu betrachten. Zu ihren Begründern zählen:
- Jacob Levy Moreno (1889 – 1974): Der österreichisch-US-amerikanische Arzt und Psychiater eröffnete den Reigen 1934 mit „Who Shall Survive?“. Diese Schrift ist 1954 auf Deutsch in revidierter Auflage von 1946 erschienen als „Die Grundlagen der Soziometrie“.
- Paul Schilder (1886 – 1940): Der österreichische Psychiater veröffentlichte 1938 „Psychotherapy“.
- Kurt Lewin (1890 – 1947): Der deutsche Sozialphilosoph und Gestaltphilosoph schrieb 1939 in Zusammenarbeit mit R. Lippitt und K. White „Patterns of Aggressive Behavior“.
Zu ergänzen ist, dass die Psychologie zwischenmenschlicher Beziehungen, für die ebenfalls Lewin steht, die Gruppenpsychologie erweitert. (siehe auch Fritz Heider, „Psychology of Interpersonal Relations“)
Ein psychologischer Weg von der Klasse als abstrakter Gemeinschaft über die Menge als konkreter Gemeinschaft führt zur Gruppe. Diese Verkettung ist Grund genug zu einer Einführung in die Psychologie der Gruppe.
Psychologie der Gruppe
Die Psychologie der Gruppe ist als erweiterte Definition der Gruppe zu lesen.
Mindestzahl der Mitglieder einer Gruppe
Die Mindestzahl der Mitglieder einer Gruppe begründet deren Existenz.
Im römischen Recht
Das römische Recht kennt den Grundsatz: „Tres faciunt collegium.“ „Drei bilden ein Kollegium“. Ein Kollegium ist eine Verbindung zu einem gemeinsamen Zweck.
Ein Kollegium ist ein Verband, aber keine Gruppe. Das römische Recht berücksichtigt die Gruppe nicht, weil es damals die massenpsychologische Einteilung der Gruppe noch nicht gab.
Im deutschen bürgerlichen Recht
Das deutsche bürgerliche Recht sieht zur Gründung eines Vereins sieben Mitglieder vor (§ 56 BGB). Die Mitgliederzahl darf nicht unter drei Mitglieder sinken, sonst verliert der Verein seine Rechtsfähigkeit (§ 73 BGB).
Der Verein ist auf einen Zweck ausgerichtet (§§ 21, 22 BGB). Er ist deshalb ein Verband, aber keine Gruppe. Das BGB kannte bei seinem Inkrafttreten von 1900 den massenpsychologischen Begriff Gruppe noch nicht, weil er erst zwanzig Jahre später entwickelt wurde. Einen Bedarf zur Anpassung gibt es bis heute nicht.
In der Soziologie
Die Soziologie beziffert die Mindestzahl einer Gruppe mit drei Mitgliedern.
In der Psychologie
Die Psychologie lässt die Gruppe bereits bei zwei Mitgliedern beginnen. Die face-to-face-Interaktion wird so zum Gegenstand der Gruppenpsychologie als Teil der Massenpsychologie.
Gemeinschaft in der Gruppe
Die Gemeinschaft in der Gruppe ist durch die drei Merkmale Kontakt, Zweck und Inneres Band charakterisiert.
Kontakt
Der Kontakt ist ein verbindendes Merkmal der Gruppe. Die Mitglieder haben engen Kontakt zueinander. Alle anderen sind Außenstehende. Zu ihnen bestehen distanzierte Verbindungen bis zu flüchtigen Kontakten. Außenstehende stehen im Wortsinn außen, haben also keine Verbindung zur Gruppe.
Zweck
Ein Zweck ist der Anlass zur Gründung einer Gruppe; dazu gehören auch gemeinsame Ziele und Aufgaben. Zu deren Erfüllung bleiben die Mitglieder längere Zeit zusammen. Innere Ziele dienen den Mitgliedern, ihre Entscheidungen zu verbessern oder die Produktivität zu erhöhen.
Inneres Band
Das innere Band der Gruppe wird durch das Wir-Gefühl bestimmt. Es entwickelt sich durch gemeinsame Erlebnisse der Mitglieder, die das innere Band festigen. Diese Erlebnisse müssen keine spektakulären Ereignisse sein. Arbeitspausen, Betriebsausflüge oder gruppeninterne Rituale bilden das Wir-Gefühl.
Organisation der Gruppe
Die Organisation der Gruppe sorgt für deren geordnete Arbeitsweise.
Rollen
Rollen spielen die einzelnen Mitglieder in einer Gruppe. Der britische Unternehmensberater Raymond Meredith Belbin (* 1926) hat in seinem 1981 erschienenen Buch „Management Teams“ acht, später neun Rollen beschrieben, die er Schlüsselrollen nennt. Sie sichern eine erfolgreiche Teamarbeit: Wegbereiter, Mitarbeiter, Koordinator, Beobachter, Inspirator, Spezialist, Umsetzer, Perfektionist und Macher.
Hierarchie
Die Hierarchie in einer Gruppe hat zwei Ausbildungen. Die erste betrifft die Führungsstruktur mit drei Ebenen. Die zweite umfasst die Gruppenstruktur mit bis zu fünf Untergruppen.
Aufgabenverteilung
Die schnelle und effektive Aufgabenverteilung in der Gruppe ist eine Voraussetzung für den Erfolg der Gruppenarbeit. Die Aufgaben sind lückenlos nach Umfang und mitgliederübergreifender Zuständigkeit zu verteilen. Die Mitglieder sind zu Rückmeldungen aufzufordern, die der Ergänzung der Aufgabenverteilung dienen.
Führung
Die Führung der Gruppe ist der Garant für ihren Erfolg. Sie hängt entscheidend von der Persönlichkeit ihres Führers ab. Der erfolgreiche Führer muss zuverlässig sein, die Motive der Mitglieder kennen und über alle gruppeninternen Vorgänge Bescheid wissen. Er benötigt bessere Handlungsmöglichkeiten als die einzelnen Mitglieder, muss danach handeln und stets im Blickpunkt der Gruppe stehen.
Gruppenphasen
Gruppenphasen sind Entwicklungsstufen einer Gruppe, die der deutsch-US-amerikanische Sozialarbeiter und Sozialwissenschaftler Louis Lowy (1920 – 1991) vorgeschlagen hat. Seine fünf Phasen sind:
- Orientierungsphase: Die Mitglieder nähern sich einander.
- Phase der Rollenbildung: Mitglieder nehmen unterschiedliche Rollen an.
- Vertrautheitsphase: Die Stabilität der Gruppe wird erreicht.
- Differenzierungsphase: So heißt die „goldene Zeit“ der Gruppe.
- Abschluss- und Trennungsphase: Sie ist die Phase der Auflösung, weil das Zusammensein der Mitglieder nicht mehr spannend ist, andere Ziele verfolgt werden sollen oder der Gründungszweck erreicht ist.
Sonderthemen zur Psychologie der Gruppe
Sonderthemen zur Psychologie der Gruppe sind der Ringelmann-Effekt und das erweiterte Duncker-Kerzenproblem.
Ringelmann-Effekt
Der Ringelmann-Effekt ist nach dem französischen Agraringenieur Maximilien Ringelmann (1861 – 1931) benannt. Ringelmann forschte zur Effizienz der Arbeit bei Pferden, Ochsen, Maschinen und Menschen.
Ergebnis seiner Forschung
Das Ergebnis seiner Forschung, der Ringelmann-Effekt, besagt: Gruppenmitglieder strengen sich weniger an, als wenn sie für sich allein arbeiten.
Experimente
In seinen Experimenten von 1882 bis1887 ließ Ringelmann Einzelpersonen und Gruppen gegeneinander Taue ziehen. Im Ergebnis schaffte eine Person 63 kg, zwei Personen zogen 118 kg, drei Personen 160 kg. Die Ziehkraft hätte steigen müssen, nahm aber deutlich ab.
Inzwischen wurde ein Dokument Ringelmanns gefunden, nach dem sich die Abnahme der Leistung ab sechs bis 15 Personen zwar abschwächte, der Grad der Abschwächung über 15 Personen hinaus aber kaum noch wahrnehmbar war.
Psychologische Interpretationen
Die psychologischen Interpretationen des Ringelmann-Effekts nahmen mit der Motivationsforschung Fahrt auf.
Motivationsforschung
Die Motivationsforschung ermittelte einen Motivationsverlust der Gruppenmitglieder.
Außerdem erlitten Testpersonen einen Koordinationsverlust und zogen dadurch in unterschiedliche Richtungen.
Die Personen, die für den Leistungsverlust verantwortlich waren, wurden als Drückeberger, Trittbrettfahrer oder soziale Faulenzer klassifiziert.
Neueste Erkenntnisse der Motivationsforschung
Die neuesten Erkenntnisse der Motivationsforschung ergeben sich aus der Trennung von Motivation und Koordination. Nach der Trennung wurde erkennbar, dass der Leistungsabfall durch die fehlende Motivation auf Social Loafing (Soziales Faulenzen) beruht.
Zusätzlich hat die Motivationsforschung die Theorie der Social Facilitation (Theorie der Sozialen Erleichterung) entwickelt. Sie besagt, dass Lebewesen im Beisein von Artgenossen bessere Ergebnisse erzielen.
Nach der Motivationsforschung laufen Social Loafing und Social Facilitation gegeneinander. Social Facilitation flacht die durch Social Loafing erwirkte Leistungsminderung ab.
Bei den Ringelmann-Experimenten gab es beim Tauziehen Situationen, in denen nicht alle Probanden am Tau zogen, sondern nur einige, und die anderen zuguckten.
Die Abflachung der Leistungsminderung setzt bei Ringelmann ab sechs Personen ein. Es ist ungeklärt, ob sie nicht bereits ab der zweiten Person eingesetzt hat. Nur der Abfall ist nach sechs Personen bei Ringelmann größer. Da die Social Facilitation keine Begrenzung enthält, beginnt sie bereits auch ab zwei Personen. Ab welcher Personenzahl und in welchem messbaren Umfang das Social Loafing einsetzt, ist noch ungeklärt; denn die Gruppenpsychologie hat sich inzwischen von der weiteren Bearbeitung des Ringelmann-Effekts abgewandt und der Motivationsforschung zugewandt.
Duncker-Kerzenproblem
Das Duncker-Kerzenproblem ist nach dem deutschen Gestaltpsychologen Karl Duncker (1903 – 1940) benannt. Dem Kerzenproblem liegt ein kognitiver Leistungstest zugrunde, den Duncker 1935 als „Schachtelaufgabe“ veröffentlichte.
Testaufbau zum Kerzenproblem
Im Testaufbau zum Kerzenproblem sollen Probanden eine Kerze an einer Kork-Wand anbringen und anzünden, ohne dass Wachs auf den darunter stehenden Tisch tropft. Dazu erhalten sie eine Kerze, ein Heftchen mit Streichhölzern und eine Schachtel mit Reißzwecken.
Lösung des Tests
Zur Lösung des Tests kann die Kerze nicht an die Wand genagelt werden, weil die Reißzwecken zu kurz sind. Deshalb ist die Schachtel an der Wand zu befestigen. Danach ist die Kerze in die Schachtel zu stellen und anzuzünden.
Das Problem der Lösung liegt für die Probanden in der Überwindung ihrer funktionellen Fixiertheit auf die Schachtel. Sie nehmen die Schachtel als Aufbewahrungsort der Reißzwecken und nicht als Teil der Lösung wahr.
Erweiterung des Tests
Die Erweiterung des Tests nahm 1962 der kanadische Psychologe für figurative Sprache Sam Glucksberg (1933 – 2022) zur Erforschung der Motivation der Probanden vor.
Glucksberg forderte in Erweiterung des Tests alle Teilnehmer auf, das Kerzenproblem zügig zu lösen. Eine Gruppe der Probanden sollte zusätzlich eine Belohnung erhalten, die anderen nicht.
Ergebnis des erweiterten Tests
Das Ergebnis des erweiterten Tests sollte die Frage beantworten, wie Geld als Anreiz die Motivation der Probanden beeinflusst.
Das erzielte Ergebnis war: Die Teilnehmer mit versprochener Belohnung waren deutlich langsamer als die anderen.
Infolge des unerwarteten Ergebnisses ist der Test bis in die Gegenwart zig-mal wiederholt worden. Das Ergebnis wurde jedes Mal bestätigt, es gilt also als gesichert.
Erkenntnis aus dem erweiterten Test
Die Erkenntnis aus dem erweiterten Kerzenproblem lautet: Das Out-of-the-Box-Denken (über den Tellerrand hinaus) wird durch materielle Anreize eher behindert.
Call-to-Action
Zur weiteren Lektüre sind die Blogbeiträge
empfohlen.
Fazit
Die Darstellung der Gruppe ist notwendig, damit die Gruppendynamik vor dem Aus einzuschätzen ist. Die Gruppe ist die Voraussetzung zur Gruppendynamik. Sie ist massenpsychologisch eine Gemeinschaft neben der Masse, der Menge, der Klasse und dem Verband. Sie besteht aus einer Mindestzahl an Mitgliedern, die einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Ihre Organisation setzt sich aus den Rollen der Mitglieder, einer Hierarchie und ihrer Führung zusammen. Ihre Existenz ist in Gruppenphasen unterteilt. Eingeschränkt wird ihre Leistungsfähigkeit durch den Ringelmann-Effekt und behindert durch das erweiterte Duncker-Kerzenproblem.
Teil 2 erläutert auf der Grundlage von Teil 1 die Psychologie der Gruppendynamik. Anschließend beantwortet er die Frage, ob die Gruppendynamik vor dem Aus steht.
